– Es gilt das gesprochene Wort! –
Leitwort als Auftrag
Sehr geehrte Delegierte, liebe Freunde,
„für Freiheit, Frieden und Verständigung“ – unter diesem Leitwort haben wir uns in diesem Jahr hier versammelt. Das klingt einerseits wie eine Bilanz unserer OMV-Arbeit seit den Anfängen – oder doch zumindest seit 1989/90, wenn wir den Untertitel dazu nehmen.
In diesem Sinne darf ich Sie jetzt alle für die nächste Stunde um absolute Ruhe und Konzentration bitten. Sonst werde ich mit meinem Bericht nicht fertig, bevor wir direkt danach und ohne weitere Diskussion Bernhard Vogel hören wollen. Scherz beiseite.
Denn andererseits, meine Damen und Herren, ist unser diesjähriges Motto viel mehr als ein Rückblick: Es ist ein Auftrag. Und es bleibt ein Auftrag – auch fast 75 Jahre nach Kriegsende und dem Beginn von Flucht und Vertreibung, fast 70 Jahre nach der Verkündung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen und 30 Jahre nach dem Mauerfall und dem Ende des Kalten Krieges.
Für mich war es auch ein Auftrag, mich nicht nur in Berlin – in den Sitzungen des CDU-Bundesvorstandes und anderen Gremien – sehen zu lassen, sondern vor Ort – mit Ihnen und den Verbänden der Vertriebenen – das Gespräch zu suchen. So habe ich versucht, meine erste Amtszeit als OMV-Bundesvorsitzender zu gestalten – neben meinen regulären Aufgaben als stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender in Thüringen. Daher möchte ich heute lieber eine Rede halten, als stur über die Arbeit der OMV zu berichten. Unsere Tätigkeiten finden Sie in den Tagungsunterlagen gut zusammengestellt.
Zur Unrechtsstaatsdebatte
Warum unser Motto ein Auftrag bleibt, ist gerade zum Tag der Deutschen Einheit und im Zuge der Wahlen in Polen einmal mehr deutlich geworden. Denn es zeigte sich massiv, dass wir uns nicht nur mit den Nachbarländern, sondern auch in Deutschland selbst noch auf Vieles verständigen müssen.
In Deutschland erklären etwa der Kommunist aus Niedersachsen, der Thüringen regiert, und die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die DDR sei kein Unrechtsstaat gewesen. Und dann lassen die das zum 7. Oktober veröffentlichen – dem Gründungstag der DDR. Was für eine Schande! …
Ich war – ehrlich gesagt – zunächst etwas sprachlos, weil die Kommunisten in Thüringen vor fünf Jahren die Koalitionszusage mit genau diesem Bekenntnis zur „DDR als Unrechtsstaat“ erkauft hatten. Aber irgendwann fallen alle Masken!
Seither haben viele Redner versucht, dies gerade zu rücken. Bundeskanzlerin Angela Merkel, unsere Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, aber auch mein CDU-Landesvorsitzender Mike Mohring – alle haben deutliche Worte gefunden. Dafür bin ich sehr dankbar.
Andere aber haben weiter in diese Kerbe gehauen. Die Lebensleistungen der DDR-Bürger würden herabgewürdigt, hieß es. Diktatur, ja – Unrechtsstaat, nein… Ja, aber was ist denn eine Diktatur anderes als ein Unrechtsstaat?
Und können wir es den Menschen, die vor 30 Jahren im Kampf gegen ebenjenes Unrecht ihre Freiheit erlangt haben, heute nicht mehr zumuten, das System, das sie damals besiegten, als das zu bezeichnen, was es wirklich war?
Meine Damen und Herren, Sie wissen, ich bin in der DDR aufgewachsen. Konnte man heimatliche Gefühle in diesem Land entwickeln? Ja, das konnte man. Konnte man sich der scheinbaren Rechtsstaatlichkeit entsprechend systemkonform verhalten und Repressionen vermeiden? Ja, das konnte man – zumindest in den meisten Fällen. Konnte man sich bilden, sich ein Leben aufbauen, eine Familie gründen und zu bescheidenem Wohlstand gelangen? Ja, auch das konnte man – wenn es dabei auch oft Hindernisse gab.
Natürlich gab es auch Dinge, die gut funktionierten in der DDR. Manche von denen werden jetzt als scheinbare Neuerungen hintenrum wieder eingeführt. Und das, meine Damen und Herren, schmerzt viele ehemalige DDR-Bürger, weil ihnen diese Dinge „als neue Errungenschaften“ verkauft werden, weil sie sich nicht für dumm verkaufen lassen wollen und weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Aber das setzt doch das Unrecht nicht außer Kraft, das der DDR quasi ins Erbgut geschrieben war!
Hingerichtete CDU-Mitglieder aus Obergebra
Ich will Ihnen kurz von einem Beispiel aus der Anfangszeit der DDR berichten: 1952 wurde in meiner Heimatstadt Obergebra im Kreis Nordhausen – wie vielerorts – in den 1. Mai hineingefeiert. Im Wirtshaus wurde getrunken und offen diskutiert, ja sogar über unterschiedliche politische Ansichten gestritten.
Man wähnte sich weit weg von Ost-Berlin. Da fiel auf einmal ein örtlicher SED-Funktionär um und war tot. Niemand hatte ihn angerührt. Es gab Zeugen. Vielleicht hatte er zu intensiv mit zwei jungen CDU-Mitgliedern gestritten und einen Herzinfarkt erlitten.
Genau diese beiden jungen Menschen aber wurden sofort als Sündenböcke festgenommen. In Windeseile wurde ihnen der Prozess gemacht. Sie wurden zum Tode verurteilt und am 6. September 1952 mit der Guillotine hingerichtet. Kopf ab – einfach so.
Und um die Angehörigen zu demütigen, wurden die Überreste der Ermordeten verbrannt und die Urnen in einem Massengrab in Dresden verscharrt. Mehr noch: Dem tragisch verstorbenen SED-Mann errichtete man ein Denkmal. Und auch damit noch nicht genug: Der CDU-Ortsverband Gebra wurde von CDU-Generalsekretär Gerald Götting aufgelöst und Aktivitäten der CDU verboten. Das war die SED-„Demokratie“ – und der Opportunismus der wohlgelittenen Spitzen-CDU-Leute!
Sie können sich nicht vorstellen, was für eine Genugtuung es für mich war, diesen Ortsverband in den 80er-Jahren wieder gründen zu können – und in den 90ern dafür zu sorgen, dass die beiden jungen Leute rehabilitiert wurden und das Denkmal wieder abgerissen wurde.
Hubschrauberpiloten in der Wendezeit
Aber lassen Sie mich Ihnen noch ein zweites Beispiel nennen, das Gott sei Dank nie handfestes Unrecht geworden ist. Diesmal aus den letzten Tagen der DDR: In Nordhausen waren einige Hubschrauberstaffeln stationiert; mit den Piloten sprach ich hin und wieder. Sie hatten die Ereignisse auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking gesehen. Und sie glaubten allen Ernstes, sie wären im Fall der Fälle im Recht – und könnten die Demonstrierenden in Leipzig, in Dresden, in Berlin und sonst wo ebenfalls alle zusammenschießen.
Diese Überzeugung widerspiegelte die Einstellung vieler SED-Funktionäre und Systemlinge, bis in die höchsten Ränge. Es war damals Michail Gorbatschow, der beruhigend auf die DDR-Führung einwirkte. Hätte er anders reagiert, hätte er nicht in stetem Dialog mit Helmut Kohl gestanden – und Bush, und Mitterand und Thatcher: Wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre.
Alltägliches Unrecht
Ich will Ihnen auch erzählen, wie weit die Willkür und das Unrecht in den Alltag hineinreichten. Ich habe es schon bei der Landestagung der OMV NRW vor zwei Wochen gesagt: Meine Mutter stammte aus NRW. Meine Oma lebte bis zu ihrem Tod 1967 in Düsseldorf.
Meine Mutter und ich beantragten damals, zur Beisetzung reisen zu dürfen. Genehmigt wurde das nicht. Die Oma wurde von Fremden in die Erde gesenkt… Und das war beileibe kein Einzelfall, sondern die Regel!
30 Jahre nach dem Tag, an dem mit dem Berliner Mauerfall – ich sage mal – die entscheidende Lücke in den Eisernen Vorhang gesägt wurde, und angesichts der aktuellen Debatten ist es wichtig, gerade auch die Erinnerungen an dieses Alltagsunrecht hervorzuholen.
Neben den unzähligen Menschenrechtsverletzungen im Großen muss auch an die Willkür im Kleinen erinnert werden, mit der sich die Bürger tagtäglich herumärgern mussten. Die sie verletzte, die sich in ihren Köpfen festsetzte. Über die sie innerhalb der Familien immer und immer wieder sprachen. Das, meine Damen und Herren, waren die Tropfen, die das Fass füllten – und es am Ende bei so vielen Bürgern der damaligen DDR zum Überlaufen brachten! …
Und ich bin der festen Überzeugung, man unterschätzt all diese Menschen, wenn man glaubt, sie könnten ihre Lebensleistung nicht von diesem – ich sage es deutlich – Unrechtsstaat DDR trennen. Immerhin haben sie ihn ganz gezielt, aktiv und friedlich zu Fall gebracht. Seine Unmenschlichkeit ist nicht nach einem verlorenen Krieg einfach untergegangen, wie wir das bei Nazi-Deutschland erlebt haben. Wir haben allen Grund, stolz und dankbar zu sein, liebe Freunde. Gut, dass wir heute die Freiheit haben!
Vertriebene in der DDR
Meine Damen und Herren, Sie können mir glauben: Ich könnte noch lange weiter über das Leben in der DDR und das SED-Unrecht sprechen. Wie es heute beschönigt wird, wie es romantisiert wird – und wie gerade der öffentliche Rundfunk in Mitteldeutschland dies mit ermöglicht mit seinen fürchterlichen DDR-Heimatschnulzen.
Aber ein weiterer Aspekt liegt mir aus der Sicht der OMV besonders am Herzen: das Unrecht, das diejenigen deutschen Heimatvertriebenen und Flüchtlinge erfahren mussten, die in der SBZ bzw. der DDR strandeten. Wir alle hier wissen, dass deren Vertreibungen über Jahrzehnte als „Umsiedlungen“ verharmlost wurden. Dass die Betroffenen mit ihrem Schicksal nicht nur alleingelassen wurden, sondern es sogar verleugnen sollten.
In der DDR-Bildungspolitik spielte das Thema keine oder eine absichtlich historisch falsche Rolle.
Ich freue mich daher, dass wir morgen die Gelegenheit haben werden, mit Roland Jahn zu sprechen – dem Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen – und vielleicht auch zu den Vertriebenen in der DDR mehr zu erfahren.
Dieses Unrecht mag Gott sei Dank mit der DDR zu Ende gegangen sein, aber gerade die fehlende Bildung wirkt nach: Vom Handwerker bis zum habilitierten Akademiker – auch unter CDU-Mitgliedern – wird unseren Anliegen mancherorts bestenfalls mit leeren Blicken, schlimmstenfalls mit einer aus Unkenntnis ideologisch motivierten Ablehnung begegnet.
Daher haben wir in der OMV auch in den letzten zwei Jahren wieder darauf hingewiesen, dass man hier besonders sensibel sein muss und dass man in der Schul- und Hochschulbildung, lieber Werner Jostmeier, nachsteuern muss – aber auch in der politischen Bildung, lieber Rüdiger Goldmann.
Das gilt im Übrigen aus anderen Gründen genauso für den Bereich des früheren Westdeutschland. Sie sehen in den Tagungsunterlagen: Wir haben zum Gesamt-Thema Bildungspolitik einen Antrag von der OMV NRW vorliegen.
Ich selbst habe das Ganze etwa im Gespräch mit Innenminister Horst Seehofer oder im Stiftungsrat der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ im Beisein von Kulturstaatsministerin Monika Grütters und der Direktorin Dr. Gundula Bavendamm vorgebracht – aber auch im CDU-Bundesvorstand.
Für mich persönlich ist dieses Thema eng verbunden mit einem weiteren DDR-Unrecht: der Beseitigung der Grenzbesiedlung in der DDR ab dem Jahr 1952. Offiziell geschah dies, um die innerdeutsche Grenze „zu sichern“. Wohl aber eher, um Menschen von der Freiheit fernzuhalten! Und wissen Sie, wie man diese Operationen damals bezeichnete? Mit „Aktion Ungeziefer“ oder „Aktion Kornblume“! Ein Hohn!
Ja, auch dieser Heimatraub war ein Verbrechen, das nicht gesühnt wurde und dessen Wunden noch immer nicht verheilt sind. Und ich werbe immer wieder dafür, wenigstens eine Geste der Wiedergutmachung zu erreichen, solange noch Opfer am Leben sind. Es wäre schön, wenn uns dies gelänge.
Nochmal: Genau wie die Nazi-Verbrechen, genau wie Flucht und Vertreibung der Deutschen, genau wie das Schicksal unserer heimatverbliebenen Landsleute oder der in die Weiten Sibiriens oder Kasachstans verschleppten Russlanddeutschen darf auch das Unrecht des DDR-Regimes in seiner ganzen Breite niemals in Vergessenheit geraten. Dies bleibt für uns als Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung ein wichtiger Auftrag!
Und ich weiß unsere Landesverbände dabei an unserer Seite. Insbesondere die neuen Bundesländer – lieber Christoph Bergner, lieber Adolf Braun. Aber auch Niedersachsen, wo unser Helmut Sauer in seiner aktiven Abgeordnetenzeit maßgeblich zum Weiterbestand der Zentralen Erfassungsstelle für die SED-Verbrechen in Salzgitter beigetragen hat. Oder NRW, lieber Heiko Hendriks, wo bis heute der „Nationale Gedenktag des deutschen Volkes“ am 17. Juni regelmäßig begangen und an die Opfer des SED-Regimes erinnert wird. In Bayern sprach ich letztes Jahr am 17. Juni bei einem Vertriebenenkongress der UdV zu dem Thema.
Das alles bleibt wichtig, und es ist gut, dass wir uns in diesem Jahr schwerpunktmäßig auch damit befassen.
Freiheit und Frieden in Europa
Aber es geht uns heute nicht nur um Erinnerungskultur und Aufarbeitung. Es geht uns auch um Anliegen, die uns noch immer, immer wieder oder gerade neu beschäftigen. Freiheit und Frieden in Europa etwa lassen sich nur erreichen, sichern und bewahren, indem wir uns immer und immer wieder für grenzüberschreitende Verständigung einsetzen. Das wissen wir – und das tun wir als OMV. Im Kleinen wie im Großen.
Klar ist, dieser Einsatz wurzelt in der Charta der deutschen Heimatvertriebenen von 1950. Und ich bin insbesondere der UdVF Baden-Württemberg, liebe Iris Ripsam, sehr dankbar, dass Ihr Jahr für Jahr in Stuttgart an die Unterzeichnung und die nach wie vor wichtigen Inhalte der Charta erinnert. Letztes Jahr durfte ich dort sprechen.
Die Charta ist ein in vieler Hinsicht visionäres Dokument – ein in Zeiten größter Not entstandenes „Gründungsdokument der Bundesrepublik Deutschland“, wie unser ehemaliger Bundestagspräsident Norbert Lammert zu sagen pflegte. Der Einsatz für ein geeintes Europa, der darin formuliert ist, meine Damen und Herren… –
Ich meine: Natürlich wurde von den Vertriebenen in Westdeutschland auch zu Zeiten des Kalten Krieges im Wege der Volksdiplomatie der Kontakt mit der Heimat gesucht. Ich höre noch heute die Berichte darüber, wie schwierig das alles war.
– … aber so richtig konnte der grenzüberschreitende Einsatz der Vertriebenen für Verständigung erst aufkeimen, nachdem hunderttausende mutige Bürger der DDR die Mauer zu Fall gebracht hatten, nachdem in Polen die kommunistische Diktatur niedergerungen war, nachdem die Tschechoslowakei und Ungarn sich geöffnet hatten usw.
Ja, der friedliche Protest vor 30 Jahren und die in Gang gesetzte Kettenreaktion haben Europa nicht nur die Freiheit gebracht – sie haben uns einander näher gebracht. Gerade die Umbrüche in Deutschland und in Polen wurden für andere Länder zum Modellfall. Sie haben Identität, Stabilität und Einheit gestiftet und das Verständnis füreinander gestärkt. Die radikalen politischen Veränderungen damals waren notwendig, um erstmals Freiheit zu ermöglichen.
Und so ging das „Tor zur Heimat“ auf, wie es Heiko Hendriks sagte. So rückte „die Heimat wieder näher“, wie es unser Freund, BdV-Präsident Bernd Fabritius, immer wieder erklärt.
Aber erst das neue Miteinander mit dem Ziel eines geeinten Europa – dieser nach innen wie außen wirkende, fortwährende Einsatz für Verständigung – sorgte und sorgt dafür, dass uns diese Freiheit erhalten bleibt.
„Freiheit will immer wieder neu errungen sein.“ Alt-Bundespräsident Joachim Gauck hat das gesagt. Das Präsidium des Bundes der Vertriebenen wird ihn im November mit der Ehrenplakette des Verbandes auszeichnen. Dieses Zitat kann man heute nicht oft genug wiederholen – gerade heute, wo einige politische Kräfte wieder das Gegeneinander instrumentalisieren und nationalistische Alleingänge versuchen. Das stiftet Uneinigkeit, treibt Europa auseinander und schränkt letztlich Freiheitsrechte ein! Und das, meine Damen und Herren, wollen wir nicht!
Grenzüberschreitende Arbeit
Wir sind also gefordert, die Quellen von Freiheit und Stabilität in Europa zu erhalten und weiter zu stärken – den Frieden zu sichern durch Verständigung. Mitteleuropa und insbesondere die Beziehungen, die Deutschland mit seinen östlichen Nachbarländern pflegt – mit Polen, mit Tschechien, aber auch mit Nachbarn im weiteren Sinne wie etwa Ungarn, Rumänien, der Ukraine, der Slowakei oder Russland –, stehen dabei besonders im Fokus.
Hier entfaltet die Arbeit der deutschen Heimatvertriebenen und ihrer Verbände – hier erhält die Arbeit der OMV, die meist Hand in Hand geht mit dem Einsatz der deutschen Volksgruppen in diesen Ländern eine wichtige Bedeutung. Gemeinsam treten wir gleichermaßen für ein weiter wachsendes Verständnis füreinander ein, wie für gemeinsame Anliegen im Identitäts-, Sprach- und Kulturerhalt unserer Deutschen in der Heimat.
Das klingt jetzt ziemlich abstrakt.
Wir hatten Bernard Gaida und die Arbeitsgemeinschaft deutsche Minderheiten zu Gast im OMV-Bundesvorstand. Es ging z.B. um die Schulproblematik, um Gesetzesänderungen zulasten der Deutschen in Polen, aber auch um blockierte Mittel seitens unseres SPD- Auswärtigen Amtes. Den letzten Punkt konnten wir mit Hilfe von Bernd Fabritius – hier als Minderheitenbeauftragter der Bundesregierung – innerhalb kürzester Zeit rückgängig machen. Wir haben uns auch in den anderen Punkten für die Minderheiten eingesetzt.
Ich selbst war mehrfach bei unseren heimatverbliebenen Landsleuten zu Gesprächen – am St. Annaberg, in Ohlau, in Breslau, in Lemberg, aber auch in Russland. Und ich weiß, dass viele Mitglieder unseres Bundesvorstandes ebenso den direkten Kontakt in die Heimat pflegen.
Rüdiger Goldmann etwa nach Gablonz und ins umliegende Sudetenland, aber als „Gebirgsschlesier“ – wie er auch immer mal sagt – ebenfalls nach Schlesien. Bernd Fabritius ist sowieso gefühlt die Hälfte der Zeit in Siebenbürgen, die zweite Hälfte in Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken – und die dritte Hälfte in Sachen BdV unterwegs. Vielen Dank Ihnen allen – und auch denjenigen, die ich jetzt nicht namentlich genannt habe, und all jenen, die in unseren Landesverbänden unermüdlich für die Anliegen der Minderheiten eintreten und grenzüberschreitend für Verständigung werben.
Vertriebenenpolitik ist Europapolitik
„Wir setzen uns dafür ein, dass deutschen Minderheiten in den Ländern, in denen sie leben, eine Perspektive zum Bleiben geboten wird. Alle Deutschen sollen selbst entscheiden können, ob sie in Deutschland leben oder in den Herkunftsgebieten bleiben wollen.“ Diese Sätze haben wir 2013 in unser Regierungsprogramm eingebracht.
Damals ging das noch, einfach so. Es kam ganz demokratisch zustande. Aber mal abgesehen davon, dass ich diese Zeilen heute sofort wieder so unterschreiben würde: Aus den dort dargelegten Gründen springen wir als OMV nicht über jedes außenpolitische Stöckchen, das uns hingehalten wird – sagen wir mal: von der PiS.
Zum Ersten: Natürlich ist eine von der PiS geforderte Symmetrie in der Förderung der Deutschen in Polen und der polnischen Zuwanderer in Deutschland großer Käse! Gerade die nationalistische PiS sollte wissen, dass man angestammte Minderheiten besser nicht in einen Topf mit Zuwanderern wirft.
Mag sein, dass es zukünftig möglich wird, verstärkt Polnisch-Unterricht an deutschen Schulen zu bekommen. Mag sein, dass man Programme zum Kultur- und Identitätserhalt der Polen in Deutschland von deutscher Seite stärker fördert. Es gibt ja für viele Fragen auch Lösungen.
Aber einer Gleichstellung dieser Gruppen werden wir nicht zustimmen! Und ich bin mir sicher, das wird am Runden Tisch – der ja in diesem Jahr neu aufgelegt wurde – auch so kommuniziert. Weil das Thema aber genau dorthin gehört, machen wir nicht jede Woche eine Pressemitteilung dazu, da bitte ich schon um Verständnis. Wir sprechen mit unseren Leuten.
Zum Zweiten: Natürlich hat die PiS mit ihren exorbitanten Reparationsforderungen außenpolitisches Porzellan zerschlagen – nur um ihr Wahlergebnis aufzupolieren. Erfolgreich, wie wir gesehen haben.
Leider so erfolgreich, dass Bernd Fabritius als Minderheitenbeauftragter der Bundesregierung gleich die erste Gelegenheit genutzt hat – nutzen musste, nach Allenstein zu reisen und dort mit Verantwortungsträgern, dem Marschall und dem Woiwoden etc. über die Situation unserer Leute dort zu sprechen. Er lässt sich herzlich entschuldigen – insbesondere, weil er trotz seiner Abwesenheit selbstverständlich wieder für den neuen OMV-Bundesvorstand kandidieren möchte.
Wenigstens hat die deutsche Minderheit ihren Abgeordneten Ryszard Galla wieder durch die Wahl gebracht. Für ihn wird es jetzt sicher erneut eine Herausforderung, Verbündete im Sejm zu finden.
Ich bin nur froh, dass die Bundesregierung Reparationsforderungen immer wieder sehr nüchtern ablehnt. Denn auch das Unrecht, das den Heimatvertriebenen und Heimatverbliebenen widerfahren ist, lässt sich nicht in Geldbeträge umrechnen.
Das zerstörte oder zerrissene Lebensglück, der zurückgelassene Hof, die verlorene Heimat mit ihren Menschen, mit der Landschaft, mit Feldern, Wiesen und Wäldern… All das kann man sich mit allem Geld der Welt nicht zurück kaufen. Und auch die Jahre, in denen man als Unschuldiger Zwangsarbeit in Lagern wie Potulitz, Lamsdorf und Zgoda leisten musste… Oder die Jahrzehnte, in denen man gezwungen war, nur hinter verschlossenen Türen Deutsch zu sprechen und in denen Kinder benutzt wurden, um ihre Eltern auszuspionieren und zu brandmarken, können nie mit Geld wiedergutgemacht werden. Zumindest einige in der deutschen Presse sind darauf gekommen – und, wie ich hörte, auch Teile der polnischen Presse.
Uns geht es dabei nicht darum, die entsetzlichen Verbrechen kleinzureden, die von den Nationalsozialisten in Polen begangen wurden. Es bleibt selbstverständlich in unserer Verantwortung, solche Verbrechen nie wieder zuzulassen. Es bleibt genauso in unserer Verantwortung, Flucht und Vertreibung – und ein Schicksal wie das der Deutschen in der Heimat mit der Unterdrückung in den kommunistischen Unrechtsregimen – zukünftig wirksam zu verhindern.
Von daher führen uns solche Äußerungen und solche vorübergehenden politischen Phasen immer wieder vor Augen, wie wichtig und notwendig unsere Arbeit für grenzüberschreitende Verständigung ist. Und dass wir uns nicht auf die gleiche Ebene außenpolitischer Auseinandersetzung begeben sollten, wenn wir das Wohl unserer Landsleute im Blick haben. Unsere moderne Vertriebenenpolitik ist und bleibt zu einem wichtigen Teil Europapolitik, und da braucht es schon etwas Fingerspitzengefühl!
Aktuelle Kulturpolitik
Unsere Landsleute in der Heimat sind immerhin diejenigen – und damit komme ich zum nächsten Thema, meine Damen und Herren –, die gemeinsam mit den Vertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern – gemeinsam mit uns – die deutsche Geschichte und Kultur unserer Heimatgebiete pflegen und fortentwickeln.
Ja, wir sind als Kulturträger zwei Seiten einer Medaille. Wir sind diejenigen, die diese Kultur noch aktiv leben. Sicher ist die Arbeit von Museen, Archiven und die Konservierung von Geschichte wichtig. Sicher ist die wissenschaftliche Aufarbeitung von Geschichte und Kultur notwendig und erkenntnisreich. Aber das wichtigste Ziel muss es doch sein, die Kulturträger selbst – beiderseits der Grenzen – in ihrer eigenen, vielseitigen Arbeit und in der Schaffung neuer Kulturleistungen zu unterstützen.
Dafür brauchen wir auch weiterhin funktionierende Verbandsstrukturen – hüben wie drüben! Das habe ich bei der Landsmannschaft Westpreußen im letzten Jahr erklärt, das habe ich beim Bund der Vertriebenen in Schleswig-Holstein gesagt, das erkläre ich auch den Entscheidern in der Politik, wie etwa meinem – noch amtierenden – roten Ministerpräsidenten in Thüringen. Und ich werde das auch immer wieder sagen!
Wir setzen uns als OMV im Kulturerhalt für ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Politik und Verbänden ein. Es gibt hier durchaus positive Signale und Entwicklungen: Die Förderungssituation hat sich seit den dramatischen Einschnitten unter Rot-Grün wieder verbessert. Wir sind, rein von den Zahlen her, jetzt wieder auf einem Niveau wie zu Helmut Kohls Zeiten. Aber auch, wenn ich an den Koalitionsvertrag oder an die Neukonzeption der Bundesregierung zur Kulturarbeit nach § 96 des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes denke: Da wird eine Wertschätzung unserer eigenen Institutionen und ein partnerschaftlicher Ansatz sichtbar – auch mit den deutschen Volksgruppen. Und das ist gut!
Und ich will es einmal so sagen: Auch wenn sicher nicht jede Stiftungsratssitzung der „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ zu ihrer Zufriedenheit abläuft – grundsätzlich steht unsere Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Grütters, unseren Anliegen durchaus positiv gegenüber.
Wir wünschen uns aber – und das kann ich angesichts des Antrags, den die UdVF eingebracht hat, ganz offen sagen – einen Inflationsausgleich und eine noch stärkere Konzentration der Förderung auf die aktiven Kulturträger. Wir wissen doch: Alles ist teurer geworden seit 1998. Und die Arbeit nicht einfacher. Also, hier müssen wir dran bleiben!
Aktuelle Anliegen der Aussiedler
Ein anderes Thema, an dem wir dran bleiben müssen, ist die Rentensituation unserer Aussiedler.
Ich brauche hier gar nicht ins Detail zu gehen. Die Vertreter der Betroffenen – lieber Johann Thießen, liebe Albina Nazarenus-Vetter, lieber Adolf Braun und alle anderen – sitzen heute mit im Raum und scharren mit den Füßen, wann immer dieses Thema auf den Tisch kommt.
Nur so viel: Die aktuellen Schlagworte, mit denen über die Rentengerechtigkeit gesprochen wird, können wir nur als Hohn empfinden. „Generationengerechtigkeit“, „Respektrente“ oder „Lebensarbeitsleistung“… Wie sollen das die Betroffenen verstehen, die hierher nach Deutschland – in ihre Wurzelheimat – von uns eingeladen wurden? Denen wir gesagt haben: Wir übernehmen die Verantwortung für das Kriegsfolgenschicksal, unter dem ihr bis heute leidet?
Eigentlich ja auch eine Selbstverständlichkeit.
Und die jetzt im Alter trotz eines harten Arbeitslebens und trotz einer Kinder- und Enkelgeneration, die viel in die Rentenkasse einzahlt, weniger als die Grundsicherung hat?
Der Bund der Vertriebenen engagiert sich hier seit Jahren gemeinsam mit den Verbänden der Betroffenen, lieber Johann Thießen. Und ich weiß, Bernd Fabritius setzt sich nicht nur als BdV-Präsident, sondern auch als Bundesbeauftragter für Aussiedlerfragen zu jeder Gelegenheit für eine Lösung dieser Frage ein. Die Aussiedlerbeauftragten der Länder – wir werden sie morgen hören: Editha Westmann, Margarete Ziegler-Raschdorf, Heiko Hendriks, aber auch alle anderen, die heute nicht hier sind – stehen in der Sache sicher hinter ihm. Aber auch wir als OMV haben das Thema auf dem Schirm. Und unsere Fraktionsgruppe im Bundestag unter Eckhard Pols ist natürlich auf unserer Seite.
Aber die SPD mauert total. Ja, man hört sogar: Das Fremdrentenrecht soll am besten rück-abgewickelt werden. Und wenn ich ehrlich bin: Auch die eigenen Parteifreunde sind hier nicht immer richtig informiert. Sie sehen manchmal nicht, dass man unsere Stammwähler mit einem guten Ergebnis in diesem Bereich von der AfD oder von den Linken zurückgewinnen könnte. Auch deswegen werden wir hier in unseren Bemühungen nicht nachlassen!
Es ist – so sagt es Christoph Bergner immer – unsere Aufgabe als OMV und als CDU/CSU – die Aussiedler in ihrer „Selbst-Definition als Deutsche“ zu unterstützen. Und ich sage: Ja, wir können das! Aber wer die Spätaussiedler von vornherein als Migranten – als Fremde ansieht – der kann das nicht. Hier müssen wir also wieder mehr Sensibilität erzeugen…
Mehr Sensibilität, aber vor allem auch mal ein deutliches Signal seitens der Partei braucht es beim Netzwerk Aussiedler der CDU. Es gab vor über einem Jahr einen CDU-Bundesvorstandsbeschluss, das Netzwerk einzuberufen. Seither ist Ruhe.
Meine Damen und Herren, ich weiß, es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie dieses Netzwerk in Zukunft fortgeführt werden soll. Ich stehe dazu u.a. in Kontakt mit CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und auch mit dem bisherigen Vorsitzenden Heinrich Zertik. Daher würde ich vorschlagen, dass ich mich heute Abend – nachdem Sie mich vielleicht wiedergewählt haben werden – mit den Funktionsträgern unserer Aussiedler mal zusammensetze, und dass wir dort mal ganz offen darüber sprechen. Ist das ein Vorschlag, lieber Herr Thießen? Frau Nazarenus-Vetter? Herr Gauks? Adolf?
Rekurs Leitwort
Meine Damen und Herren, wie angekündigt, bin ich hier nur schlaglichtartig auf unsere Arbeit in den letzten zwei Jahren eingegangen.
Es gäbe noch viel zu sagen: etwa zur Zwangsarbeiterentschädigung, wo jetzt rund 85 Prozent der Anträge bearbeitet sind. Oder zur erwähnten Stiftung im Berliner Deutschlandhaus, wo nun im kommenden Jahr endlich mit dem Einbau der Ausstellung begonnen wird. Oder zu Fragen der Aufnahme und Eingliederung unserer Aussiedler…
Sie sehen: 30 Jahre nach dem Mauerfall – 75 Jahre nach Flucht und Vertreibung: Es bleibt noch viel für uns zu tun.
Zum diesjährigen Jubiläum ist es für uns wichtig, auch immer wieder daran zu erinnern, dass die deutschen Heimatvertriebenen, Flüchtlinge und Aussiedler in ihren Verbänden, aber gerade auch in unseren Unionsparteien und in der OMV einen wichtigen Teil dazu beigetragen haben, dass die Vereinigung von BRD und DDR gelingen konnte.
Denn sie waren es, die das Ziel, die deutsche Teilung zu überwinden, stets im Blick behalten haben. Und sie waren über viele Jahrzehnte außerdem wichtige Ansprechpartner für die Menschen, denen die Flucht oder die Aussiedlung aus der DDR oder den anderen Unrechtsstaaten im Osten gelang. Sie wurden von links als Revisionisten verurteilt – und waren doch eigentlich Visionäre, meine Damen und Herren!
Ich habe das landauf landab deutlich gesagt. Wo immer ich für die OMV gesprochen habe: ob in Ihren Landesverbänden oder den BdV-Gliederungen oder im Ausland. Und ich weiß, dass viele von Ihnen das genauso gemacht haben. Haben Sie vielen, vielen Dank dafür!
„Für Frieden, Freiheit und Verständigung“. Das bleibt unser Auftrag. Und ich würde mich freuen, wenn es auch mein Auftrag bliebe – hier an der Spitze der OMV. Daher möchte ich Sie herzlich bitten, mir nachher Ihr Vertrauen für eine zweite Amtszeit zu geben. Wenn Sie denn mit meiner – „Performance“ sagt man heute, glaube ich – zufrieden waren.
Dank Vorstand und Ende
Meine Damen und Herren, heute geht die Wahlperiode eines OMV-Bundesvorstandes zu Ende. Und ich kann hier nicht vom Pult weggehen, ohne allen Bundesvorstandskollegen ganz herzlich für ihren ehrenamtlichen Einsatz zu danken.
Es war eine gute Zeit mit konstruktivem Austausch. Wir haben einiges vorangebracht. Vielen, vielen Dank!
Ausdrücklich aber möchte ich noch den beiden Kollegen danken, die sich heute nicht zur Wiederwahl stellen: Gudrun Osterburg und Ulrich Caspar, zwei Hessen.
Frau Osterburg ist zehn Jahre lang stellvertretende Bundesvorsitzende gewesen und davor vier Jahre lang Beisitzerin in unserem Bundesvorstand. Sie hatte als langjährige UdV-Vorsitzende in Hessen und Vorsitzende des zuständigen Unterausschusses im Landtag umfassenden Einblick in die Arbeit der OMV und der Vertriebenenverbände. Sie hat unsere Anliegen meist ruhig, aber mit großem Nachdruck vertreten. Leider kann sie heute aus gesundheitlichen Gründen nicht hier sein.
Herr Caspar arbeitet seit sechs Jahren als Beisitzer im Bundesvorstand. Er ist noch immer UdV-Landesvorsitzender in der Nachfolge von Frau Osterburg. Aber er hat sich nach dem Rückzug vom Landtagsmandat bei der letzten Wahl in Hessen jetzt einer neuen Aufgabe zugewandt: Er ist Präsident der IHK Frankfurt. Und als solcher, das darf ich vielleicht verraten, hat er den neuen OMV-Bundesvorstand schon jetzt im Dezember nach Frankfurt eingeladen – um vor Ort mit uns über berufliche Perspektiven von Aussiedlern in Deutschland zu sprechen.
Meine Damen und Herren, sollten Sie jetzt klatschen wollen, weil meine Rede zu Ende ist, dann schließen Sie doch bitte Frau Osterburg, Herrn Caspar und den gesamten scheidenden Bundesvorstand mit in Ihren Applaus ein.
Danke sehr.
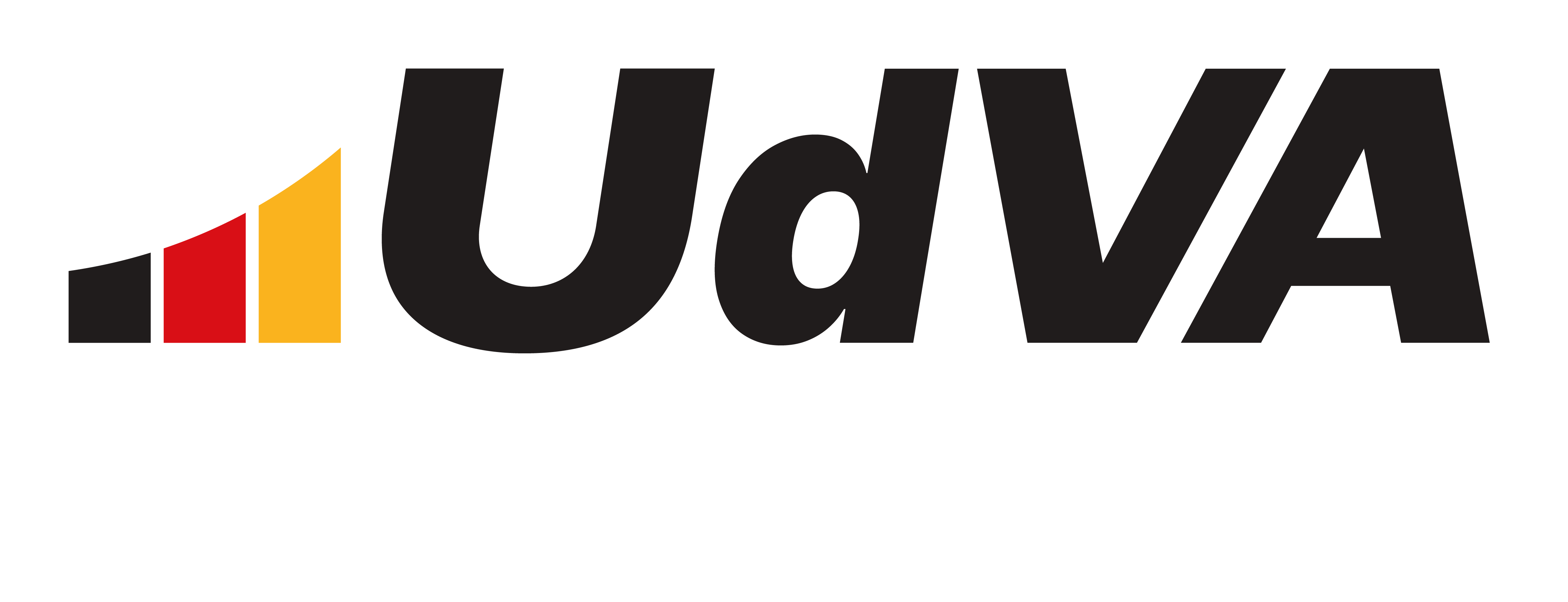
Empfehlen Sie uns!